
Daniel Becksche Lederfabrik
- Neben der Tuchmacherei ist im 18. und 19. Jahrhundert in Döbeln die Gerberei die wichtigste Handwerkerinnung der Stadt. Wegen der mit der Gerberei verbundenen Geruchsbelästigung und weil die Gewässer durch das Waschen der Tierhäute und die Entsorgung von Gerbstoffen und -laugen meist stark verschmutzt werden, dürfen die Gerber ihr Handwerk nur außerhalb der Stadtmauern verrichten. So entsteht in Döbeln nördlich der Staupitzstraße ein Gerbereiviertel. Ein Unternehmer ist besonders erfolgreich.
- 1820 gründet Daniel Wilhelm Beck (geb. am 27.02.1797) in der Döbelner Staupitzstraße seine Gerberei und baut das Unternehmen schnell zu einer Manufaktur, später zu einer Fabrik aus.
- Sie umfasst Lohgerberei (spezielle Form der Gerberei mit pflanzlichen Gerbmitteln, die Rinderhäute zu strapazierfähigen, kräftigen Ledern verarbeitet), Weißgerberei (Gerbverfahren, bei dem die Gerbung mit Mineralien wie Alaun oder Kochsalz bewirkt wird, was besonders helles, fast weißes Leder erzeugt), Lohmühle (dient zur Zerkleinerung der für die Lohgerberei notwendigen pflanzlichen Gerbmittel, vor allem Fichten- und Eichenrinden) und Leimfabrik (Fleisch und Hautabfälle der Gerbereien werden zu Knochenleim weiterverarbeitet).
- Drei Dampfmaschinen sind im Unternehmen im Einsatz. Die Fabrikation dominiert ein ganzes Stadtviertel. Nördlich der heutigen Staupitzstraße erbaut Beck insgesamt 52 Gebäude. Die Lohgerberei (gegr. 1838) wird in vier Haupt- und zehn Nebengebäuden betrieben. Die Lederlackiererei und Leimsiederei benötigt drei Haupt- und zwei Nebengebäude und in einem Haupt- und dreizehn Nebengebäuden ist die Papier-, Pappen- und Pressspanfabrik (gegr. 1851) untergebracht.
- Haupterzeugnisse des Unternehmens sind Roß- und Rindverdeckleder, Geschirrleder, Kalb-, Schaf- und Ziegenfelle und schwarze Bockfelle. In der Lackiererei wird lackiertes Roß- und Rindverdeckleder, lackierte Kalb-, Schaf- und Ziegenfelle produziert. Die Leimsiederei stellt mehrere Sorten Leim her. In der Papier-, Pappen- und Preßspanfabrik fertigt man Papier, Pappe (hauptsächlich Dachpappen) und Pressspäne.
- Immer wieder kommt es im Laufe der Geschichte des Unternehmens auch zu Rückschlägen. In den 1850er Jahren legt ein großer Brand die Becksche Lederfabrik fast gänzlich in Asche. Der Brand dauert acht Tage. In verschiedenen Gebäuden an der Staupitzstraße lagerten 1 Million Lohkuchen, die Feuer fingen und nicht zu löschen waren. Lohkuchen ist zu Ballen geformte und getrocknete Gerberlohe (zum Gerben verwendete Baumrinde oder Blätter). In der Regel handelt es sich dabei um Rinde, Blätter oder Holz von Eichen (Eichenlohe) und Fichten, die sehr gerbstoffreich.
(1) Leder-Manufactur von D. Beck in Döbeln. Im Hintergrund sieht man den damals noch unbebauten Leipziger Berg (auch Staupitzberg).
(2) Wer Höhe Parkhaus an der verlängerten Ritterstraße steht und Richtung Staupitzstraße blickt, hat ungefähr die Perspektive auf die frühere Ledermanufaktur.
(3) Papier-, Pappen- und Preßspanfabrik von D. Beck in Döbeln.
(4) Wer an der Einmündung der Rudolf-Breitscheid-Straße in die verlängerte Ritterstraße steht (Höhe Sparkasse) und Richtung Staupitzstraße blickt, hat ungefähr die Perspektive auf die frühere Papier-, Pappen- und Preßspanfabrik.
(5) Leder-Lackiererei, Leimfabrik und das Grabmal von D. Beck in Döbeln. Das Grab lag unterhalb eines kleinen Weges, der damals in die Klostergärten führte. Heute befindet sich an dieser Stelle der Parkplatz oberhalb des Stadtbades.
(6) Auf diesem Areal zwischen Mulde und Staupitzstraße befanden sich die Leder-Lackiererei und die Leimfabrik. (Foto 2024)
- Diese Artikel finden ihren Hauptabsatz in Deutschland, aber auch im Orient. Bei der Vermarktung konzentriert man sich auf die Leipziger Messen. Die Firma beschäftigt im Vertrieb drei Handlungsreisende und in der Produktion fünf Werkführer sowie 260 Arbeiter (Stand 1856).

- Am 28. Juli 1860 stirbt Daniel Beck in Dresden, wo er zur Kur weilte. Auf seinen Wunsch hin wird er in der Nähe seiner Fabrik, auf einem von seinem Vater geerbten Gartengrundstück in einer einfachen, aber geschmackvoll angelegten Ruhestätte beerdigt. Das Grab liegt unterhalb eines kleinen Weges, der in die Klostergärten führt, kurz vor der ehemaligen "Deutschen Schänke zur Sorge", nördlich vom Hallenbad, dort wo sich heute ein Parkplatz befindet. Es wird in den 1950er Jahren beseitigt.
- Beck vererbt das Unternehmen an seine drei Söhne Oskar Rudolph Beck, Guido Eugenius Beck und Paul Johannes Beck, welche den Betrieb fortführen.
- Die Bedeutung Daniel Becks für die Wirtschaftsgeschichte Döbeln besteht darin, dass er als erster Unternehmer der Muldenstadt den Übergang vom Manufakturbetrieb hin zu einer fabrikmäßigen Produktion vollzieht. Insofern ist er der erste Industriepionier Döbelns. Seine zahlreichen Produktionsstätten an der Staupitzstraße vereinigen eine größere Anzahl unterschiedlicher Arbeitsvorgänge und immer mehr werden Maschinen eingesetzt. Das Personal besteht zunehmend nicht mehr aus Handwerkern, sondern immer mehr aus Produktionsarbeitern, die für einen spezialisierten Arbeitsgang zuständig sind. Dass hier ein besonders innovativer Unternehmer wirkt, erkennen auch die sächsischen Könige. Sowohl König Friedrich August II., als auch König Johann besuchen bei ihren Aufenthalten in Döbeln die Fabrikanlagen Daniel Becks.

- 1870 ist die Lederfabrik die Drittgrößte Deutschlands und beschäftigt bis zu 350 Arbeiter.
- 1871 wird die Fabrik in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und firmiert unter "Sächsische Lederindustrie-Gesellschaft, vormals Daniel Beck". Die Söhne scheiden aus dem Unternehmen aus. 1876 hat die Gesellschaft ein Kapital von 1 050 000 Mark.
- Der Gründerkrach 1873 hat negative Auswirkungen, weil die Firma stark vom Kapitalmarkt abhängig ist.
- In den 1880er Jahren kommt das Unternehmen zunehmend in eine Schieflage. Die Großproduktion rentiert sich nicht mehr und ist zu unflexibel.
- Unter Direktor Levy wird nochmals versucht, den Niedergang abzuwenden. Man spezialisiert sich auf die Anfertigung schwarzer und brauner genarbter und satinierter Kalbfelle sowie von Kidleder (weiches Ziegenleder). 150 Arbeiter sind in Lohn und Brot.
- Leider ist der Erfolg nicht von Dauer. 1894 geht die Sächsische Lederindustrie-Gesellschaft in die Liquidation.
- Seit 1896 erfolgt der Umbau der Gebäude in der Staupitzstraße zu Wohnhäusern. Die Schornsteine der früheren Fabrik werden gesprengt.

Lederfabrik Guido Beck
- 1870 gründet Guido Beck, ein Sohn Daniel Becks, am linken Arm der Mulde, gegenüber dem Schloßberg eine mit Dampfkraft betriebene Ledermanufaktur und Lacklederfabrik.
- Er verarbeitet hauptsächlich Bullenhäute, die man mit Spaltmaschinen in eine Narben- und eine Fleischseite teilt. Nach der Gerbung werden die Häute genärbt und glatt lackiert. Das fertige Lackleder verkauft man weltweit. Aus ihm stellt man Schuhe her oder verwendet es in Sattlereibetrieben oder im Wagen-, später beim Automobilbau.
- Um die Jahrhundertwende wird das Ledergeschäft immer schwieriger. In einigen Gebäude auf dem Fabrikgelände siedeln sich andere Firmen an. 1912 eröffnet hier zum Beispiel die Holz-Riemscheiben-Fabrik Hiehle & Tischer.
- Nachfolger Guido Becks wird sein Sohn Arndt Beck. Er hat sich der Herstellung von Boxcalf zugewendet. Als Boxcalf bezeichnet man Leder vom Milchkalb. Die besonderen Merkmale des Boxcalf-Leders bestehen in der leicht schattigen Optik, dem seidigen Glanz und dem sehr feinen, gleichmäßigen Narben.
- Arndt Beck betreibt das Unternehmen bis 1933.

Weiß- und Sämischgerberei Zaak

- Neben dem "Platzhirsch" Daniel Beck siedeln sich auch andere Gerber an der Staupitzstraße an. Östlich des Staupitztores, mit der Innenstadt durch den Staupitzsteg verbunden, gründet 1856 August Böhme in der Staupitzstraße 6 seine Gerberei. Er stellt Felle für Kürschner und Pelzschneider nach dem Prinzip der Fettgerbung her.
- 1908 übernimmt Gustav Schwarze die Gerberei.

- Zwischen den beiden Weltkriegen kommt es teilweise zu einer Umstellung auf Chromgerbung u.a. für Stiefelleder.
- Seit 1956 wird das Unternehmen als reine Sämischgerberei betrieben. Die Sämischgerbung ist eine Art der Fettgerbung zur Herstellung von Leder. Sämischleder (Chamoisleder) werden mit Gerbstoffen auf der Basis oxidierbarer Fette hergestellt.
- In der Gerberei produziert man Fenster- und Autoleder, auch individuelle Lohngerbung gehört zum Angebotsspektrum.

- Zur Gerberei Zaak gehört ein Mansardengiebelhaus in der Staupitzstraße 6, das als Wohnhaus genutzt wird. Dahinter sind drei weitere Gebäude um einen kleinen Innenhof gruppiert, in denen sich die Gerberei befindet. Genutzt werden ein Seitengebäude und ein zweigeschossiges älteres Gerbereigebäude. Neben diesem befindet sich ein Gebäude, dessen Untergeschoss aus Bruchsteinen noch aus den Gründerjahren der Gerberei stammt. Es wird 1964 zu einem viergeschossigen Produktionsgebäude erweitert.
- Nach der Wende gerät die in der fünften Generation im Besitz der Familie Zaak befindliche Gerberei besonders durch die billige außereuropäische Konkurrenz in Bedrängnis. Pläne, die Gerberei als Schaubetrieb einem größeren Publikum zu öffnen, werden nicht verwirklicht.
- Auch wenn es heute keine Gerberei als Schaubetrieb in Döbeln gibt, können wir uns anhand der folgenden Bildergalerie vorstellen, wie die Arbeit in der Gerberei Zaak in den 1970er Jahren aussah. Die Fotos, die freundlicherweise die Familie Zaak zur Verfügung stellte, geben wertvolle Einblicke in den Arbeitsalltag einer Gerberei.
- Am 30.04.1997 wird das Gewerbe abgemeldet.
- Das alte, für das Gerberviertel typische Wohnhaus an der Staupitzstraße wurde, wie auch die benachbarten Häuser, abgerissen. Die Produktionsgebäude im hinteren Teil des Grundstücks sind noch heute erhalten, werden aber derzeit nicht genutzt.
Lederfabrik Richard Hempel
- Richard Hempel gründet seine Lederfabrik 1884 direkt gegenüber des Staupitzstegs.
- In einem mehrgeschossigen Produktionsgebäude stellt er schwarzes und farbiges Futterleder für die Schuhproduktion her.
- Das Haus gibt es heute noch. Es wird für Wohnzwecke genutzt.

© Michael Höhme, "Traditions- und Förderverein Lessing-Gymnasium Döbeln" e.V.
Quellen:
Pressausschuss für das Heimatfest (Hg.): Aus der Heimat. Festschrift zum Heimatfest. Döbeln 20.-22. Juni 1914, S. 81ff.
Stockmann, Gottfried: Die Stadt Döbeln als Standort der Industrie. Borna Leipzig 1928, S.38ff.
Materialsammlung Karlheinz Enzmann (nicht veröffentlicht)
Seidel, Hans Friedrich: Döbeln - Begräbnisstätten von frühester Zeit bis in die Gegenwart. In: Heimatgeschichtliche Beiträge III. Döbeln 1993, Einzelgrab von Daniel Beck, S.49f.
Bildnachweis:
(1)/(3)/(5) - Album der Sächsischen Industrie, Zweiter Band, Druck und Verlag von Louis Oeser in Neusalza, 1856
Werbeanzeige 1910 - Schwender, Carl Clemens: Döbeln in Sachsen in Wort und Bild. Döbeln 1910
Giebelfoto Gerberei Zaak, Werbeflyer Autoleder - Stadtarchiv Döbeln
Fotos zum Arbeitsalltag der Gerberei Zaak - Fam. Zaak (privat)
Alle Abbildungen ohne Vermerk stammen aus der „Sammlung Döbeln“ von Michael Höhme.
-
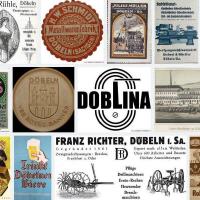
Döbeln und seine Traditionsbetriebe
-
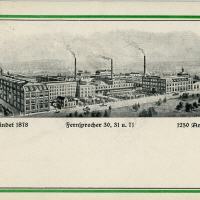
Döbeln und seine Industriegeschichte
-
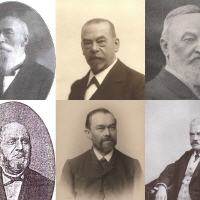
Döbeln und seine Industriepioniere










































